Vor Kurzem habe ich ein Freiwilliges Soziales Jahr im Bereich der stationären Pflege abgeschlossen. Meine Einsatzstelle war eine Klinik im Saarland. Ich kann nun auf ein Jahr zurückblicken, in dem ich zahlreiche Erfahrungen gesammelt habe und mich persönlich weiterentwickeln konnte.
Das Freiwillige Soziale Jahr ist ein Freiwilligendienst für junge Menschen zwischen 15 und 27 Jahren, der in gemeinwohlorientierten Einrichtungen stattfindet und auf eine Dauer von bis 18 Monaten ausgelegt ist. Organisiert und durchgeführt wird das FSJ von anerkannten Trägern.
Sehr ähnlich ist der sogenannte Bundesfreiwilligendienst (kurz: BFD), der 2011 nach Aussetzung der Wehrpflicht eingeführt wurde. Im Gegensatz zum FSJ wurde er als „Freiwilligendienst aller Generationen“ konzipiert und ist daher auch für Menschen über 27 offen.
Die durchschnittliche Arbeitszeit beträgt bei BFD und FSJ ca. 38 Wochenstunden, es wird also in Vollzeit gearbeitet. Als Gegenleistung für diese Zeitspende ist ein Taschengeld vorgesehen, wobei die Beträge von Träger zu Träger stark schwanken können. Im Jugendfreiwilligendienstegesetz wurde ein Höchstbetrag für das Taschengeld festgelegt, nämlich 6% der Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung.
Um zu vermeiden, dass Arbeitgeber hauptberufliche Kräfte durch verhältnismäßig günstige Freiwillige ersetzen, gilt das Prinzip der Arbeitsmarktneutralität. Demnach stehen Freiwillige zur Verfügung um unterstützende, zusätzliche Tätigkeiten zu verrichten und nicht die Aufgaben hauptamtlicher Fachkräfte. Sowohl FSJ als auch BFD können in den verschiedensten Einrichtungen abgeleistet werden. Klassische Einsatzstellen sind z.B. Kindergärten, Altenheime, Krankenhäuser und Schulen. Man kann aber auch zur Denkmalpflege, in Theatern, in politischen Zentren, an Flughäfen uvm. eingesetzt werden.
Es ist daher klar, dass die Erfahrungen von Freiwilligen so vielfältig und unterschiedlich sein können, wie die Bereiche in denen sie arbeiten. Im Folgenden möchte ich daher nur meine Perspektive schildern. Diese beruhen auf meinen Erfahrungen und Aussagen anderer FSJler*innen, die ebenfalls in der Pflege gearbeitet haben. Dabei beginne ich kurz mit meiner Situation vor meinem FSJ und reiße kurz meine Einarbeitungszeit im Krankenhaus an.
Vor etwa anderthalb Jahren bestand ich mein Abitur. Das Gefühl von Freiheit hielt etwa so lange an wie ich nicht von Fragen durchlöchert wurde. Wie jeder nach einem Schulabschluss wurde ich von allen Seiten halbherzig gefragt: „Was machst du danach? Wo? Und wann?“
Ich wusste es nicht, auch wenn ich mich nie getraut hätte das zuzugeben. Der Gedanke nach 12 Schuljahren weitere 5 Jahre an einer Hochschule zu verbringen bereitete mir jedoch Bauchschmerzen. Deswegen entschied ich mich ein FSJ zu machen- um eine Auszeit vom Lernen zu haben, um etwas Sinnvolles zu tun und mich selbst besser kennenzulernen.
Mein Entschluss wurde nicht gerade begrüßt: „Mach kein FSJ!“, „Du verschwendest damit ein ganzes Jahr“, „Das ist Ausnutzung“. Anfang Oktober 2019 war mein erster Arbeitstag. Eine Praktikantin half mir passende Arbeitskleidung zu finden. Kupfersulfatblau, unisex, einfach fantastisch. Um sechs Uhr begann die Dienstübergabe. Alle Patienten wurden mit Blick auf Krankheitsbild, Selbstständigkeit, körperlicher und psychischer Verfassung usw. besprochen. Ich trank Kaffee und machte mir Notizen, obwohl ich von Gesagten nichts verstand. Die Gesichter der Krankenpfleger*innen am Tisch sahen müde aus – trotzdem scherzten alle miteinander.
Eine Krankenpflegerin nahm mich mit in ein Patientenzimmer. Sie begann mit der Körperpflege eines Patienten und erklärte mir die Arbeitsschritte. In meinem ersten Monat lernte ich die Aufgaben kennen, die Praktikanten, Pflegeschülern und Freiwilligen zufielen und gewöhnte mich an den Ablauf der Frühdienste. Dienstübergabe, Waschen, Frühstück anreichen, Blutdruck messen, Dauerkatheterbeutel leeren, “Auf die Klingel gehen“, Botengänge, und natürlich Patienten helfen.
Wenn ich Zeit hatte, konnte ich fahrbare Wägen mit Pflegeartikeln und Wäsche aufüllen oder die Patientenzimmer mit Handschuhen, Schutzhosen u.ä. bestücken. Es dauerte eine Weile, bis ich mich einigermaßen gut zurechtfand. Mir fehlte anfangs der Überblick, bei manchen Aufgaben war ich zaghaft oder ekelte mich.
Es gibt gute Tage und schlechte Tage.
“Der Jungreporter”-Autorin über ihr FSJ in der Pflege
Über Wochen und Monate wurde ich selbstständiger und gewöhnte mich endlich an meinen Alltag in der Klinik. Sobald ich eingearbeitet war, begann die Arbeit mir Spaß zu machen. Die Aufgaben waren zwar eher repetitiv, aber jeder Tag war etwas anders. Fast jeden Tag lernte ich neue Patienten kennen. Alle brachten unterschiedliche Geschichten mit sich. Außerdem kam ich in den Genuss des medizinischen Wissens meiner Kollegen, die mir meine Fragen mit Geduld beantworteten. Das intensive Arbeiten im Team erzeugte ein Gefühl von Gemeinschaft. In meinem Team etwas beizutragen und gleichzeitig sinnvolle Arbeit zu leisten, stärkte mein Selbstbewusstsein. Zukunftsängste und Unsicherheit wurden schwächer.
Es gibt gute Tage und schlechte Tage. Gute Tage sind nicht leicht zu definieren, ich würde sagen, dass an ihnen gute Pflege in einem guten Arbeitsklima möglich ist. Man hat genug Zeit zum regelmäßigen Lagern, zum Waschen, um Gespräche mit Patienten zu führen und zu beobachten, ob sich ihr Zustand verbessert oder verschlechtert.
An schlechten Tagen ist es dagegen schwierig einen Überblick über das Geschehen zu behalten. Es kann durchaus passieren, dass Menschen mit starken Schmerzen lange auf ihre Schmerzmittel warten müssen, dass kaum Zeit ist um jemanden auf Toilette zu begleiten, dass Patienten und Angehörige wütend werden, weil sie sich schlecht behandelt fühlen. Es sind Tage, an denen stundenlang gewaschen wird und an denen Krankenpfleger*innen fast ununterbrochen durch die Gänge hasten. Und natürlich sind es auch Tage an denen viel schief gehen kann. Die Schuld sehe ich in keinem Fall beim Pflegepersonal – viele haben Schichten gehabt, an denen sie kaum einen Schluck Wasser trinken oder auf Toilette gehen konnten. Wenig wunderlich ist, dass zwischen schlechten Tagen und Unterbesetzung ein direkter Zusammenhang besteht. Eine einzige Krankmeldung kann darüber entscheiden, ob die nächste Schicht zur Hölle wird oder nicht. Das Team, in dem ich eingesetzt wurde, war dies schon jahrelang gewöhnt.
Warum macht man das mit? Ich glaube, dass es schwierig sein kann, in sozialen Berufen zu streiken. Denn in diesen Berufen wird unmittelbar Verantwortung für andere Menschen übernommen. Man kann nicht einfach auf die Straße gehen, da dann im schlimmsten Fall jemand stirbt. Möglicherweise ist das ein Grund, weshalb die Zustände in der Pflege erst so spät Gegenstand des öffentlichen Diskurses wurden.
Als ich vor Jahren vom Pflegenotstand erfuhr war es fast schon ein abstrakter Begriff. Eine Bezeichnung für die Differenz zwischen der Anzahl an Fachkräften die wir brauchen und der, die wir haben. Jetzt hat der Begriff Form und Farbe angenommen. Er sieht aus wie erschöpfte Gestalten in blauen, grünen, roten und weißen Kitteln in grell erleuchteten Krankenhausfluren. Er lässt an Rückenschmerzen denken, an schlaflose Nächte und Träume, die sich auch auf Station abspielen.
Man hört es nur zu of: Pflege ist körperlich und psychisch belastend, wird schlecht bezahlt und genoss (vor Beginn der CoVid-19-Pandemie) wenig gesellschaftliche Anerkennung. Für Freiwillige kommt oft noch hinzu, dass sie kaum bezahlt werden. Der Grundsatz der Arbeitsmarktneutralität gilt dann als erfüllt, wenn durch den Einsatz Freiwilliger keine zu besetzenden Stellen gestrichen werden und auch keine Fachkräfte gekündigt werden.
Dies ist allerdings kritisch zu sehen – in einer Branche in der Pflegekräfte fluchtartig abwandern, in Teilzeit gehen oder von selbst kündigen, nähert sich die Arbeitsleistung von Praktikanten, Freiwilligen etc. der von Vollzeitkräfen an. Vor allem in der Altenpflege ist es ein Witz, von zusätzlichem Personal zu sprechen. Die zuständigen Träger reagieren bei Verdacht auf Verletzung der Arbeitsmarktneutralität indem sie sich mit der Arbeitsstelle in Verbindung setzen und z.B. Dienstpläne überarbeiten. Das ist wichtig um sicherzustellen, dass Freiwillige nicht den Sparzwängen der Einrichtungen zum Opfer fallen und Personal ersetzen. Allerdings fehlt so viel Personal, dass im Endeffekt immer Arbeiten übernommen werden, die von einer hauptberuflichen Kraft übernommen werden müssten.
Wie soll man reagieren? Auf keinen Fall sollte der Dienst hinsichtlich der Arbeitszeiten oder der Aufgaben eingeschränkt werden. Dies würde die Einsatzstellen, die ohnehin schon am Limit arbeiten, zusätzlich belasten. Man kann aber auch nicht alles so lassen wie es ist – körperliche und psychische Belastung, ungünstige Arbeitszeiten in Verbindung mit einem sehr geringen Taschengeld machen FSJ und BFD unattraktiv. Ich weiß nicht, wie oft ich schon gefragt wurde, warum ich mir das „antue“. Von Freunden, von Patienten, von Kollegen.
Freiwilligendienste tragen ein großes Potenzial in sich. Der Einsatz reduziert die Arbeitslast des Stammpersonals und schafft damit ein besseres Arbeitsklima. Pro Schicht etwa zwei Zusatzkräfte zu haben, kann die Versorgungsqualität massiv verbessern. Es müssen daher mehr Stellen für Freiwilligendienste geschaffen werden. Diese Stellen könnten besetzt werden, indem attraktive Anreize geschaffen werden und indem stärker für das FSJ, den BFD und dasFÖJ geworben wird.
Dies klingt sehr nach ökonomischem Kalkül. Für mich ist es vor allen Dingen die Gestaltung einer Win-Win-(Win-)Situation: Durch Zusatzpersonal werden Arbeitsbedingungen in der Pflege verbessert, Patienten könnten besser versorgt werden, Freiwillige erhalten die Anerkennung, die sie verdienen. Ein Beispiel für angemessene Entschädigung wären freie Bus- und Bahnfahrten. Träger und Freiwillige setzen sich seit Jahren (erfolglos) für „Freie Fahrt für Freiwillige“ ein. Oft fließt ein großer Teil des Taschengeldes in die Fahrkarten zur Dienststelle. Für den Freiwilligen Wehrdienst und für Soldaten wurden schon längst kostenlose Bahntickets beschlossen, und das fast schon nebenbei. Der monatliche Wehrsold im freiwilligen Wehrdienst wurde übrigens erst im Januar auf 1500 Euro (im untersten Dienstgrad) angehoben. FSJler und BFDler können maximal 404 Euro Taschengeld erhalten, meistens ist es aber viel weniger.
Um gegen die schlechte Reputation von Freiwilligendiensten im sozialen und ökologischen Bereich vorzugehen muss außerdem geworben werden. Auf die Personallücken in der Bundeswehr wurde sehr früh mit einem üppigen Werbeetat reagiert. Zur Zeit fehlen der Bundeswehr über 25 000 Soldaten (Stand 2019). 2018 fehlten in Krankenhäusern über 80 000 Pflegekräfe. Gute Gesundheitsversorgung muss eine absolute Priorität werden. In Zeiten einer Pandemie ist das common sense.
Dieser Artikel wurde von einer Gastautorin im Auftrag von “Der Jungreporter” verfasst.
Beitragsbild: unsplash.com / Vladimir Fedotov

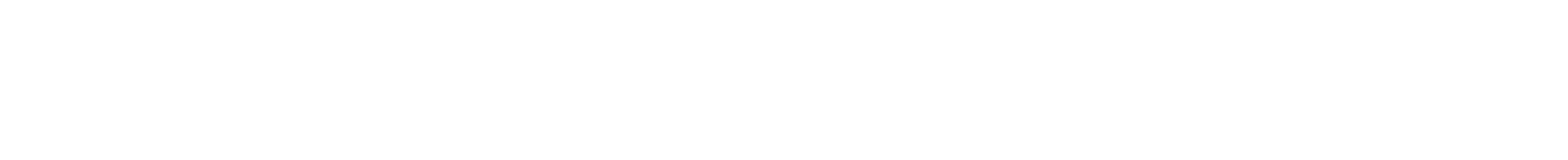
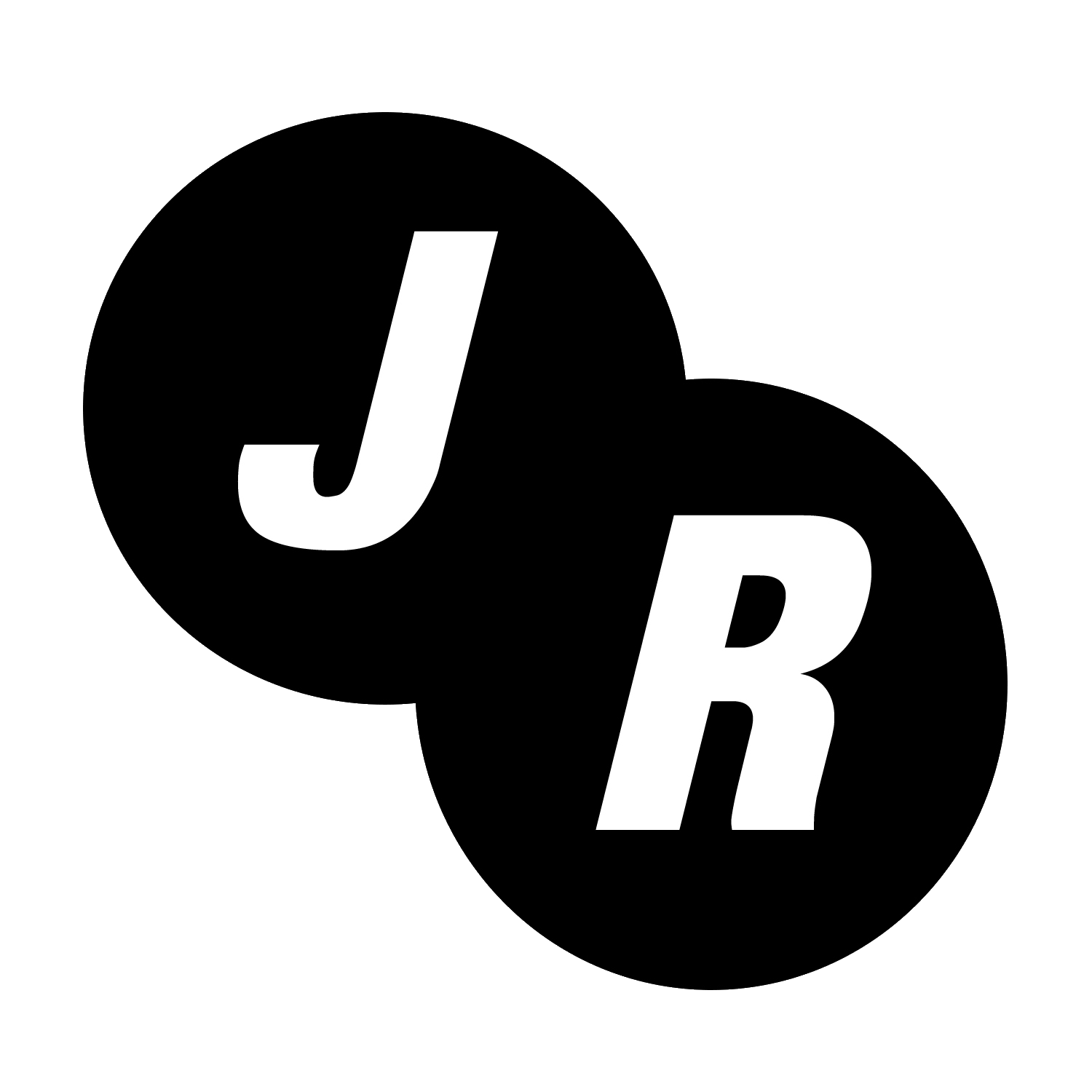









Wow… einfach nur wow… ich war mir so lange Zeit unsicher, was ein FSJ überhaupt ist oder ob das für mich ist. Dieser Artikel at alle meine Fragen beantwortet und viele meiner Zweifel beseitigt. Der Beitrag ist super geschrieben,gut verständlich und informativ. Danke!